Das Kantonale Laboratorium 2024

Susanne Nussbaumer, stellvertretende Kantonschemikerin Kanton Bern
Editorial
Mit welchen Themen hat sich 2024 das Kantonale Laboratorium des Kantons Bern beschäftigt? Welche Neuerungen standen an, und was sind die künftigen Herausforderungen?
Erfahren Sie mehr in der Video-Botschaft von Susanne Nussbaumer, stellvertretende Kantonschemikerin und Laborleiterin.
Im Fokus
Trinkwasser unter der Lupe
Sauberes Trinkwasser ist eine wichtige Grundvoraussetzung in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Für die Überwachung und Sicherstellung der Trinkwasserqualität ist das Kantonale Laboratorium zuständig. 2024 hat es insgesamt rund 2300 Trinkwasserproben im Kanton Bern erhoben und auf verschiedene Parameter untersucht.
Das Trinkwasser steht zunehmend im Fokus. Vermehrt ist es verschiedenen Nutzungskonflikten ausgesetzt: Einerseits dient es als lebenswichtige Ressource für die Bevölkerung. Anderseits wird es durch Agro-Chemikalien, industrielle Emissionen und zunehmende Umweltverschmutzung belastet. Zudem stellt der Klimawandel mit veränderten Niederschlagsmustern und extremen Wetterereignissen eine zusätzliche Herausforderung dar.
Die Verantwortung für die Qualität des abgegebenen Trinkwassers liegt bei der Wasserversorgung. Sie informiert die Konsumierenden umfassend und mindestens einmal pro Jahr über die aktuelle Qualität des abgegebenen Trinkwassers. Das Kantonale Laboratorium hingegen ist für die amtliche Überwachung des Trinkwassers im Kanton Bern zuständig.
Vor diesem Hintergrund hat das Kantonale Laboratorium 1100 Trinkwasserproben auf verschiedene chemische Substanzen geprüft. Davon wurden 157 Trinkwasserproben auf PFAS, Chlorothalonil und Metolachlor untersucht – drei Substanzenklassen, welche in letzter Zeit stark an Bedeutung zugenommen haben und vermehrt im Fokus standen:
1. PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind eine Gruppe von chemischen Substanzen, die aufgrund ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in zahlreichen Produkten wie Lebensmittelverpackungen, wasserabweisenden Textilien und Feuerlöschschäumen Verwendung finden. Sie sind persistent und können sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern.
Resultat: Die Analysen ergaben, dass sämtliche Proben die aktuell gültigen Höchstwerte für Trinkwasser einhalten. Da ab 2026 neue strengere Höchstwerte gelten werden, wurden die Messergebnisse auch mit diesen Werten verglichen. Bei einer Quelle einer Wasserversorgung würde der zukünftige Höchstwert überschritten sein. Die Wasserversorgung wurde darauf aufmerksam gemacht und wird zusammen mit dem Amt für Wasser und Abfall mögliche Lösungen für die Zukunft ausarbeiten.
2. Chlorothalonil ist ein Fungizid, das in der Landwirtschaft mehrere Jahrzehnte angewendet wurde, um Pilzbefall bei verschiedenen Nutzpflanzen (Mais, Zuckerrüben) zu verhindern. Seit 2020 ist der Wirkstoff in der Schweiz verboten. Die Metaboliten von Chlorothalonil sind stabile Abbauprodukte, die sich ebenfalls in Gewässern und damit im Trinkwasser nachweisen lassen. Seit März 2024 gilt für diese Substanzen ein Höchstwert im Trinkwasser von 0.1 µg/l.
Resultat: Obwohl Chlorothalonil seit 2020 verboten ist, wurde in 25 Proben der Chlorothalonil-Metabolit R471811 und in sieben Proben der Chlorothalonil-Metabolit R417888 mit einem Gehalt über dem Höchstwert nachgewiesen. All diese Wasserversorgungen beziehen ihr Trinkwasser aus Ressourcen, welche in einer landwirtschaftlich stark genutzten Umgebung liegen. Diese Proben wurden beanstandet. Die Wasserversorgungen wurden angewiesen, dem KL bis Ende 2024 mitzuteilen, welche Sofortmassnahmen sie einleiten konnten oder welche Massnahmen sie zusammen mit dem Amt für Wasser und Abfall mittelfristig umsetzen werden, um den rechtmässigen Zustand betreffend Trinkwasserqualität so rasch als möglich wieder herzustellen.
3. Metolachlor ist ein Herbizid, das vor allem im Mais- und Sojaanbau eingesetzt wird. Wie bei anderen chemischen Substanzen in der Landwirtschaft besteht auch hier die Möglichkeit, dass Metolachlor und seine Metaboliten über das Grundwasser ins Trinkwasser gelangen.
Resultat: Bei drei Wasserversorgungen wurde der seit 1. Oktober 2024 gültige Höchstwert von 0.1 μg/l überschritten. Dabei handelte es sich jeweils um den Metaboliten Metolachlor-ESA. Die Probenahme hatte bereits in der ersten Jahreshälfte stattgefunden. Die betroffenen Wasserversorgungen wurden nachträglich auf diesen neuen Höchstwert aufmerksam gemacht, ohne eine Beanstandung auszusprechen. Es zeigte sich, dass alle drei betroffenen Wasserversorger bereits eine Höchstwertüberschreitung bei den Metaboliten von Chlorothalonil zu verzeichnen haben. Die Umsetzung der Massnahmen zur Reduzierung der Belastung an Cholorothalonil-Metaboliten sind primär zu verfolgen und umzusetzen. Aufgrund aktueller Erkenntnisse geht man davon aus, dass sich dadurch auch die Höchstwertüberschreitungen bei den Metaboliten von Metolachlor beheben lassen.
Bakteriologische Verunreinigungen im Trinkwasser stellen nach wie vor eines der grössten Risiken für die Trinkwasserqualität dar. Das KL führte daher auch rund 1200 amtliche mikrobiologische Trinkwasseranalysen durch, um sicherzustellen, dass die bakteriologischen Anforderungen an Trinkwasser jederzeit eingehalten werden.
Resultat: Das Jahr 2024 war geprägt von mehreren regenreichen Perioden. Diese führten in gewissen Quell- oder Grundwasserfassungen dazu, dass Fäkalkeime ins Trinkwasser eindringen konnten. Als Folge davon musste das KL in acht Fällen Abkochverfügungen erlassen. In vier Fällen wurde ein rascher Einbau einer UV-Anlage verlangt. Bei den anderen vier Wasserversorgungen konnte die Ursache behoben und nach einwandfreien Nachkontrollproben die Abkochverfügung aufgehoben werden.
Fazit: Die amtliche Überwachung der Qualität des Trinkwassers zeigt eine überwiegend positive Bilanz. Die meisten vom KL untersuchten Trinkwasserproben waren einwandfrei. Es ist jedoch wichtig, dass die Wasserversorgungen auch in Zukunft ihr Trinkwasser nicht nur mikrobiologisch, sondern auch auf chemische Substanzen wie PFAS, Metolachlor, Chlorothalonil und andere Pflanzenschutzmittel untersuchen. So können mögliche Belastungen frühzeitig erkannt und nachhaltige Massnahmen zu deren Reduzierung ergriffen werden.
Zahlen & Fakten
Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure des Kantonalen Laboratoriums inspizierten im 2024 knapp 7000 Betriebe und erhoben rund 12 000 Lebensmittel-, Trinkwasser- und Asbestproben.
Tipp: Indem Sie auf die Legenden klicken, blenden Sie einzelne Komponenten aus. So werden auch tiefe Werte sichtbar.
Labortätigkeit
Von tierischen Produkten über Backwaren bis Spielzeuge: Insgesamt hat das Kantonale Laboratorium im letzten Jahr 7984 Proben untersucht und lebensmittelrechtlich beurteilt.
Von den 7984 untersuchten Proben mussten 1174 beanstandet werden. In der Grafik werden die Beanstandungsgründe anteilsmässig dargestellt.
Die Probenerhebung für die Untersuchungen erfolgte risikobasiert. Aus diesem Grund lässt die Zusammenstellung keine Rückschlüsse auf die durchschnittliche Qualität der im Markt erhältlichen Lebensmittel zu.
Inspektionstätigkeit
2024 wurden 6937 Lebensmittel- und Trinkwasserbetriebe überprüft. In 198 Fällen wurde Strafanzeige eingereicht (2023: 274). Sieben Betriebe mussten geschlossen werden (2023: 10).
Nach jeder Inspektion werden die Ergebnisse bewertet und der Betrieb in eine der Gesamtgefahren «unbedeutend», «klein», «erheblich» oder «gross» eingeteilt. Damit wird risikobasiert der nächste Inspektionstermin festgelegt.
Betriebe mit einer kleinen Gesamtgefahr werden weniger häufig kontrolliert als solche mit einer grossen Gesamtgefahr.
Im Labor
Wie viele Pestizide tummeln sich in einem Blattsalat?
Im Kantonalen Laboratorium werden ganz alltägliche Lebensmittel untersucht. Haben Sie sich schon gefragt, wie viele Pestizide in einem Kopfsalat zu finden sind? Was es bringt, wenn der Salat gewaschen wird? Und wie das KL konkret vorgeht, um Lebensmittel zu prüfen?
Stephan Lanz, Chemiker FH in der Abteilung Fremdstoffanalytik, hat die Antworten auf alle diese Fragen. Klicken Sie sich durch die Bilder in der Galerie und begleiten Sie Stephan Lanz, wie er den Blattsalat zubereitet – nicht zum Essen, sondern für die Analyse.
 Wie beim Kochen gibt es für die Messung von Pestiziden verschiedene Rezepte bzw. Analysemethoden. Um ein möglichst breites Spektrum an Schadstoffen abzudecken, wenden wir verschiedene Screening-Methoden an.
Wie beim Kochen gibt es für die Messung von Pestiziden verschiedene Rezepte bzw. Analysemethoden. Um ein möglichst breites Spektrum an Schadstoffen abzudecken, wenden wir verschiedene Screening-Methoden an.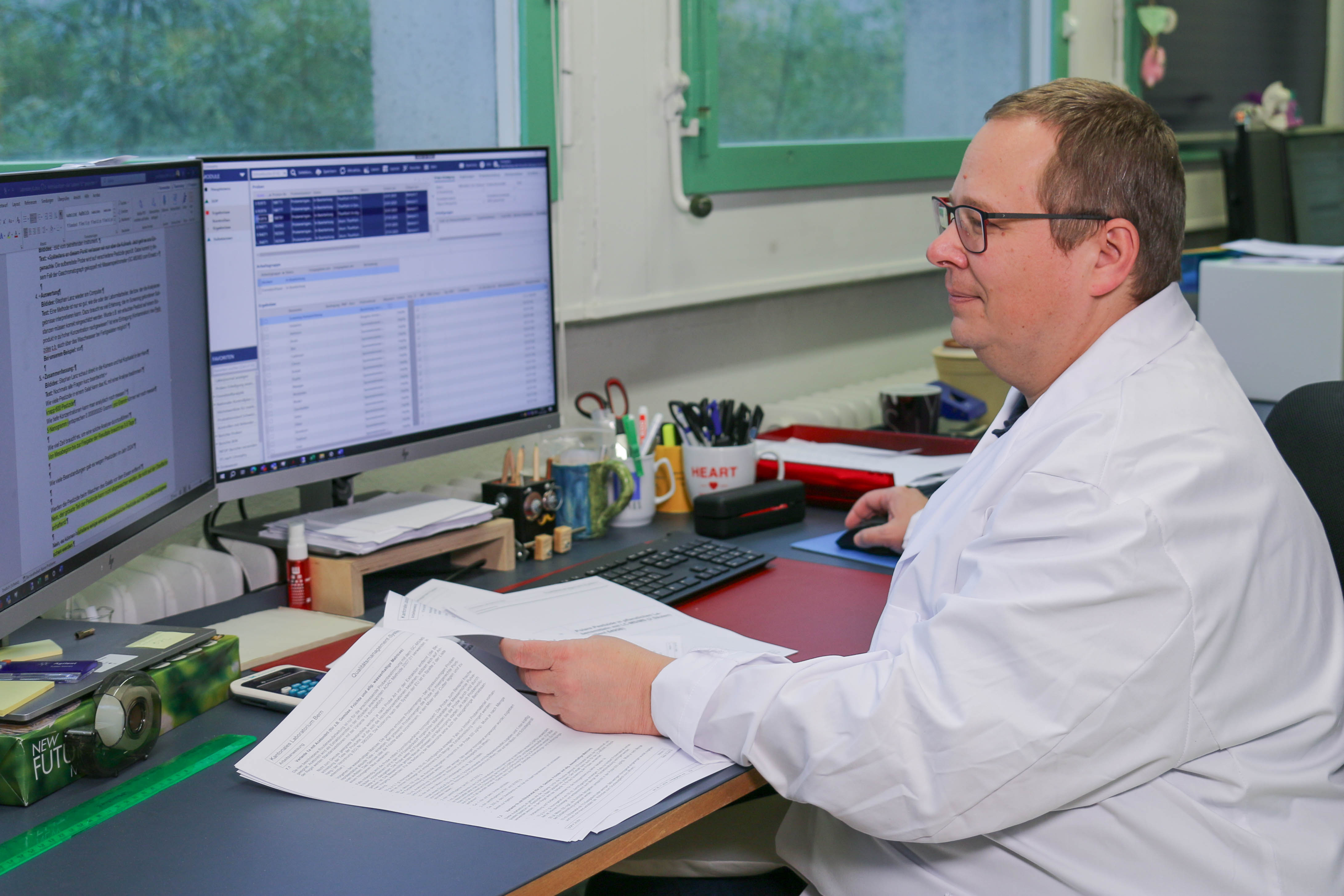 Unsere Analysemethoden werden laufend weiterentwickelt, um sie auf dem neusten Stand der technischen Entwicklungen zu halten. Dazu findet ein regelmässiger, fachlicher Erfahrungsaustausch zwischen den Fachexperten der kantonalen Laboratorien statt.
Unsere Analysemethoden werden laufend weiterentwickelt, um sie auf dem neusten Stand der technischen Entwicklungen zu halten. Dazu findet ein regelmässiger, fachlicher Erfahrungsaustausch zwischen den Fachexperten der kantonalen Laboratorien statt. Um die Probe messen zu können, muss sie aufbereitet werden. Hier könnten wir mit analytischen Fremdwörtern um uns werfen: homogenisieren, extrahieren, zentrifugieren, pipettieren, transferieren. Etwas einfacher erklärt, verläuft die Aufarbeitung so:
Um die Probe messen zu können, muss sie aufbereitet werden. Hier könnten wir mit analytischen Fremdwörtern um uns werfen: homogenisieren, extrahieren, zentrifugieren, pipettieren, transferieren. Etwas einfacher erklärt, verläuft die Aufarbeitung so: Die Probe wird in einem geeigneten Mixer homogenisiert. Dabei werden vier bis fünf Salatköpfe püriert, um eine repräsentative Menge zu erhalten.
Die Probe wird in einem geeigneten Mixer homogenisiert. Dabei werden vier bis fünf Salatköpfe püriert, um eine repräsentative Menge zu erhalten. Aus dem Salat werden möglichst alle Pestizide in ein Lösungsmittel überführt (extrahiert). Spätestens hier verlassen wir die Kulinarik, da die eingesetzten Lösungsmittel giftig sind.
Aus dem Salat werden möglichst alle Pestizide in ein Lösungsmittel überführt (extrahiert). Spätestens hier verlassen wir die Kulinarik, da die eingesetzten Lösungsmittel giftig sind. Vorhandenes Wasser wird durch Zugabe eines Salzes möglichst vollständig gebunden. Das Gemisch wird anschliessend bei 2000-facher Erdbeschleunigung zentrifugiert. Dabei entstehen verschieden feste und flüssige Phasen.
Vorhandenes Wasser wird durch Zugabe eines Salzes möglichst vollständig gebunden. Das Gemisch wird anschliessend bei 2000-facher Erdbeschleunigung zentrifugiert. Dabei entstehen verschieden feste und flüssige Phasen.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
- Mit einer Analyse können rund 600 Pestizide gleichzeitig bestimmt werden.
- Das KL kann Konzentrationen von fünf Nanogramm (entspricht 0.000000005 Gramm) pro Gramm messen.
- Von der Proben-Aufbereitung über die eigentliche Messung bis zur Freigabe der Resultate benötigt das KL drei bis fünf Tage.
- Pestizide können durch Waschen nicht entfernt werden: Sie befinden sich meist nicht auf der Oberfläche, sondern im Inneren des Salates.
- Im 2024 gab es insgesamt 16 Beanstandungen wegen Pestiziden, darunter war ein Bio-Fertigsalat.
Quiz: Testen Sie Ihr Labor-Wissen
Sind Holzkochlöffel in Profiküchen erlaubt? Weshalb sollte gekochter Reis unbedingt im Kühlschrank abkühlen? Und wie gut kennen Sie das Lebensmittelrecht?
Über uns

Das Kantonale Laboratorium (KL) ist eine Amtsstelle der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) und beschäftigt rund 70 Mitarbeitende.
Das KL ist zuständig für die Kontrolle von Lebensmitteln und Lebensmittelbetrieben, von Gebrauchsgegenständen wie Geschirr, Kosmetika und Spielzeug, Bade- sowie Trinkwasser. Zudem überwacht es die Landwirtschafts-, Umweltschutz-, Chemikalien- und Strahlenschutzgesetzgebung mit gezielten Stichproben.
Informationen
Mehr zu den detaillierten Untersuchungsergebnissen erfahren Sie in den folgenden Dokumenten.